Von Manuel Zauner
Nun, da sich mein KPJ dem Ende zuneigt, und ich doch schon mit etwas verfrüht einsetzender Nostalgie darauf zurückblicke, komme ich nicht darum herum, meine Erfahrungen währenddessen reflektorisch, sogar kritisch, zu betrachten. Ich hatte, und habe zum Glück immer noch, eine Familie, die mich in meinem Drang zur Weltenbummlerei unterstützt, und eine Universität, die mich darin ermutigt. So konnte ich als Student an den dortigen Hochschulen Nagoya in Japan, Philadelphia in den USA, Zürich in der Schweiz und sogar Dar Es Salaam in Tansania kennenlernen und in die dortige Lebensrealität eintauchen, mal tiefer oder mal doch nur in seichte Wasser waten.

Vor allem der Kontrast zwischen Ostafrika und den anderen, wohlhabenden Ländern lässt mich immer noch nicht ganz in Ruhe, und warf schon während meiner Zeit dort die Frage auf, “Was tun wir, beziehungsweise unsere Staaten und Regierungen, für Länder wie Tansania, damit die Menschen dort gut medizinisch versorgt werden und wie sieht diese Beziehung in Wirklichkeit aus?”.
Am orthopädischen Institut des Muhimbili National Hospitals, an dem ich vier Monate tätig sein durfte, erhielt ich ein paar Antworten auf diese Frage. Beispielsweise das SIGN Nail Programm, eine US-amerikanische Non-Profit-Organization, die orthopädischen Implantate konzipiert, welche auch in Ländern mit niedrigem Einkommen ohne großartige high-tech Unterstützung eingesetzt werden können, und diese auch den lokalen Krankenhäusern bereitstellt.
Dieses System kommt dort jeden Tag viele Male zum Einsatz. Ohne dieses wäre eine adäquate Versorgung von traumatischen Frakturen schlichtweg unmöglich. Die nötigen Gelder hierfür bezieht SIGN von privaten Spenderinnen und Spendern und nicht von einer staatlichen Organisation. Es war auch beeindruckend zu sehen, wie gut die Orthopädinnen und Orthopäden am Muhimbili National Hospital international vernetzt waren. Als Teil der AO Foundation, einer schweizer Stiftung, die es sich zum Ziel setzt, einen weltweiten Standard bei der Behandlung von traumatischen Verletzungen zu etablieren, können Mitglieder des Teams regelmäßig an internationalen Kongressen und Fortbildungen teilnehmen.

Auf der anderen Seite konnte ich auch das Arthroplastik-Programm kennenlernen, worauf das Institut sehr stolz ist, und wobei nur die erfahrensten Chirurgen Hand anlegen dürfen. Der Stolz ist berechtigt, denn bis vor Kurzem hat es dieses Programm überhaupt nicht gegeben. Der Grund dafür war recht simpel, die Implantate, gefertigt von westlichen Herstellern, waren kostentechnisch unerschwinglich. Doch nun, mit billigen, und nicht qualitativ schlechteren Prothesen chinesischer Manufakturen, können täglich vier Patientinnen und Patienten versorgt werden, wo es zuvor nur ein bis zwei jeden Monat waren.
Mit diesen Gedanken und Erfahrungen flog ich nach meinen 4 Monaten in Dar Es Salaam wieder nach Österreich und hatte dabei irgendwie widersprüchliche Gedanken.
Die positive Auswirkung der verschiedenen Programme war unübersehbar und ich konnte das Engagement, das alle Involvierten zeigten, hautnah erleben.
Aber kritisch gesehen waren all die Bemühungen der AO Foundation und SIGN keine strukturellen Lösungen, sondern philanthropische Projekte, die ohne wohlhabende Geldgeber, seien sie privat oder staatlich, nicht existieren würden.
Vor diesem Hintergrund, trafen die am Anfang dieses Jahres von der Trump-Regierung verkündeten Kürzungen für internationale Entwicklungshilfe, auch insbesondere PEPFAR „The U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief”, umso tiefer.
Der “President’s Emergency Plan for AIDS Relief” stellt seit 2004 einen der wichtigsten Bausteine der globalen Antwort gegen HIV/AIDS dar.

Ein mögliches Ende dieses Programms würde für die Gesundheitssysteme vieler ressourcen- und infrastrukturschwacher Länder, insbesondere in der südlichen Hemisphäre, ein Desaster bedeuten.
Um Tansania als Beispiel heranzuziehen, muss man sich die Phase der AIDS-Pandemie vor Augen führen, in der HAART („Highly Active Antiretroviral Therapy“, also die hochwirksame antiretrovirale Therapie gegen HIV/AIDS) im südlichen Afrika noch nicht verfügbar war. Im Jahr 2004 lag die HIV-Prävalenz bei 7 %, und die jährliche Zahl der Todesfälle erreichte mit 100.000 ihren Höchststand – bei einer Gesamtbevölkerung von damals 36 Millionen. Relativ zur Bevölkerung Österreichs entspräche dies 25.000 Todesfällen pro Jahr – mehr, als während der gesamten COVID-19-Pandemie zu verzeichnen waren.
Um nun den Erfolg von PEPFAR zu illustrieren, hilft es, dieselben Datenpunkte für das Jahr 2023 zu betrachten. Die Prävalenz ist mittlerweile fast auf die Hälfte gesunken und liegt derzeit bei 3,8 %. Die jährliche Zahl der Todesfälle beträgt nur noch 26.000 – bei einer stark gewachsenen Bevölkerung von inzwischen 66 Millionen.
Zahlen allein können nicht vermitteln, wie hoffnungslos die Situation auf dem Höhepunkt der AIDS-Pandemie im südlichen Afrika war und welch immenser Erfolg PEPFAR und ähnliche Programme darstellen – doch sie geben zumindest ein Gefühl für die Größenordnung. Für mich ist die eindrücklichste Zahl jene der geretteten Menschenleben: Schätzungen zufolge konnten bislang 26 Millionen Leben bewahrt werden. Doch diese Erfolgsgeschichte steht nun vor einem abrupten Ende. Erschwerter Zugang zu HAART, geschlossene Kliniken – die gesamte Reaktion droht auf ein Minimum heruntergefahren zu werden. UNAIDS, das Dachprogramm der Vereinten Nationen, warnt vor 4,2 Millionen vermeidbaren Todesfällen allein in den kommenden vier Jahren, sollten die geplanten Kürzungen umgesetzt werden. Das wäre eine echte Katastrophe für die Global Health.
An dieser Stelle lohnt es sich, einen Schritt zurückzutreten und die fahrlässige, tödliche Entscheidung der Trump-Regierung einzuordnen. PEPFAR wurde 2004 von Präsident George W. Bush als Aushängeschild der internationalen Hilfe der Vereinigten Staaten ins Leben gerufen – eine Entscheidung, die ebenso politisch wie humanitär motiviert war. Der Zeitpunkt wirft jedoch auch eine ökonomische Frage auf: Bis zur Einführung von PEPFAR kostete eine Behandlung mit HAART rund 10.000 US-Dollar pro Jahr, hergestellt von westlichen Pharmakonzernen.

Währenddessen stellte der indische Hersteller Cipla in den frühen 2000er Jahren dieselben Medikamente, zugelassen von der Weltgesundheitsorganisation WHO, um nur $350 pro Jahr her, welche bezeichnenderweise von den USA nicht zugelassen wurden.
Im Mai 2004 fand nun eine politische Kehrtwende statt. Die HAART Behandlung westlicher
Konzerne werde stark verbilligt und über PEPFAR an Länder in Not verteilt.
Hier sind klar ökonomische Interessen das Fundament für eine politische Entscheidung, und hätte es den externen Druck billiger HAART nicht gegeben, würde ich nicht darauf wetten, dass PEPFAR im selben Ausmaß finanziert worden wäre.
Die AIDS-Pandemie hat auch ihre tragischen politischen Episoden, in denen ökonomische Interessen eine wirksame Antwort verhindert haben. Die südafrikanische Regierung versuchte beispielsweise schon 1998 gesetzlich den Zugang zu leistbarer HAART zu regeln, wobei sich daraufhin jedoch 39 Pharmazeutik-Konzerne zusammenschlossen und die südafrikanische Regierung verklagten. Erst 2001 konnte, durch den Druck von Aktivisten und internationaler Empörung die Klage, abgewiesen werden. Um dieses Vorgehen der Pharmaindustrie einzuordnen, möchte ich wiederum ein paar Statistiken präsentieren.
1998 erreichte Südafrika mit 510.000 jährlichen HIV-Neuinfektionen seinen traurigen Höchststand, und 130.000 Menschen starben an AIDS. Bis 2001 stieg die Zahl der Todesfälle sogar auf 200.000. Ökonomische Interessen hatten Vorrang, und Fortschritte mussten mühsam erstritten werden. Doch in Südafrika standen Aktivisten nicht nur den Pharmakonzernen gegenüber – auch die damalige Regierung zweifelte daran, dass AIDS überhaupt durch HIV verursacht wird. Ein gefährlicher Cocktail aus Leugnung wissenschaftlicher Tatsachen und lähmender Bürokratie, der unzähligen Südafrikanern das Leben kostete.
Was für ein Fazit kann man aus diesen Beispielen ziehen, und wie kann ich meine original gestellte Frage beantworten? – Westliche, wohlhabende Staaten tragen unbestreitbar erheblich zur Gesundheitsversorgung im globalen Süden bei. Doch sind diese Programme häufig stark problemorientiert, wodurch der Fokus auf ein einzelnes Krankheitsbild eine umfassende strukturelle Analyse der gesellschaftlichen Determinanten von Gesundheit nur begrenzt zulässt. So haben die AO Foundation und das SIGN-Nail-Programm die Versorgung von Traumapatienten auf hohem Niveau ermöglicht, dennoch war eine ökonomisch tragfähige Alternative bei Gelenkprothesen notwendig, um Arthroplastiken am Muhimbili National Hospital überhaupt in größerem Umfang zu realisieren. Es ist schlicht untragbar, dass ein Großteil der globalen AIDS-Bekämpfung von den Launen des US-Präsidenten abhängt – einer einzigen Unterschrift, die Millionen Leben zerstören kann, und nach aktuellem Stand wohl auch wird.
Wir dürfen „Global Health“ nicht als bloße Floskel begreifen, sondern müssen den Begriff in seiner eigentlichen Bedeutung erfassen und als Fundament für die politischen Entscheidungen unserer Regierungen einfordern. Er muss sich von einem rein akademischen Konzept zu einem Leitprinzip der strategischen Gesundheitspolitik auf globaler Ebene wandeln. Denn in einer Zeit allumfassender Globalisierung ist der globale Süden weder fern noch fremd – unsere eigenen, wohlhabenden Gesellschaften sind unmittelbar von den sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen dort abhängig.
Wenn wir lokale Strukturen stärken, Programme schaffen, die sich an den tatsächlichen Problemen vor Ort orientieren und fest in die Gesellschaft eingebettet sind, und wenn wir die Machtasymmetrie zwischen dem globalen Süden und Norden bei gesundheitspolitischen Entscheidungen überwinden, profitieren wir als gesamte Menschheit. Dann können wir als gleichwertige Partner, und nicht als Gönner und Empfänger, in die Zukunft aufbrechen.

Wichtige Websites:
Das SIGN Nail Programm ist eine gemeinnützige Initiative, die Chirurgen in Entwicklungsländern kostenlose orthopädische Implantate und Schulungen zur Verfügung stellt. Das Programm ermöglicht die Behandlung komplexer Knochenbrüche auch in ressourcenarmen Krankenhäusern.
Die AO Foundation ist eine weltweit tätige Organisation mit Sitz in der Schweiz, die sich auf die Forschung, Ausbildung und Entwicklung im Bereich der Knochenchirurgie konzentriert. Sie bietet Schulungen und innovative chirurgische Lösungen für Frakturbehandlungen an.
Die offizielle PEPFAR-Website informiert über das US-amerikanische Regierungsprogramm zur Bekämpfung von HIV/AIDS weltweit. Sie stellt Daten, Berichte und Ziele des Programms bereit und zeigt den globalen Einfluss auf die HIV-Behandlung und -Prävention.
Diese Seite thematisiert die möglichen Auswirkungen von Budgetkürzungen bei PEPFAR auf den weltweiten Kampf gegen HIV/AIDS. UNAIDS warnt vor Rückschritten bei der Versorgung von Millionen Menschen, vor allem in Afrika.
In diesem Interview erklärt einer der Hauptverantwortlichen für die Entwicklung von PEPFAR die Hintergründe, Ziele und Herausforderungen des Programms. Es bietet Einblicke in politische Entscheidungsprozesse und globale Gesundheitspolitik.
Dieser Artikel beleuchtet die Entstehungsgeschichte von PEPFAR unter der Regierung von George W. Bush. Er beschreibt die politischen und humanitären Motive sowie die Umsetzung des bis dahin größten Gesundheitsprogramms der USA.
Der Beitrag im British Medical Journal (BMJ) berichtet über eine juristische Auseinandersetzung in Südafrika, in der es um medizinische Haftung und die Standards bei orthopädischen Implantaten geht – möglicherweise im Zusammenhang mit dem Einsatz von Programmen wie SIGN.
Ilona Kickbusch ist eine führende Expertin für globale Gesundheit. Ihre Definition von „Global Health“ betont die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, soziale Gerechtigkeit und die Bedeutung politischer Maßnahmen für die Gesundheitsversorgung weltweit.
Fotos
Bei Fragen zu Vorname Nachnames Famulatur, oder bei Fragen an Vorname Nachname persönlich, wenden Sie sich direkt an die GI-Redaktion. Schreiben Sie uns ein E-Mail an: media@goinginternational.org
Haben Sie Fragen zu den Themen Arbeiten & Weiterbildung oder Jobsuche & Karriere? Dann schreiben Sie an Frau Mag. Seitz: office@goinginternational.org
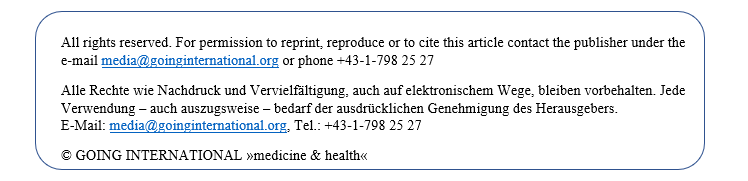
Zitierung:
Zauner, Manuel: „Global Health zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Vier Monate am Muhimbili Hospital in Dar Es Salaam, Tansania“ (In: Polak, G. [Hg.]: GI-Mail 09/2025, ISSN: 2312-0819 Going International, Wien 2025)
Diese Publikation steht hier zum Download bereit.
Wird veröffentlicht in GI-Mail 10/2025 (Deutsche Ausgabe).
- Kennen Sie unseren monatlichen Newsletter GI-Mail mit Tipps zu postgradualen Lehrgängen und Kongressen? Hier geht es zur Anmeldung.
- Sind Sie auf der Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen/Jobs & Vakanzen? Hier finden Sie die aktuellen Stellenangebote.
- Kennen Sie schon unsere monatliche Job-Information GI-Jobs mit aktuellen Stellenangeboten für ÄrztInnen, ManagerInnen und dipl. Fachpflegekräfte? Hier geht es zur Anmeldung.
- Sind Sie an neuen postgraduellen Kursen und CME-Weiterbildung interessiert? Laufend neue Kurse & Kongresse von mehr als 2300 Veranstaltern finden Sie in der Bildungsdatenbank »medicine & health«
